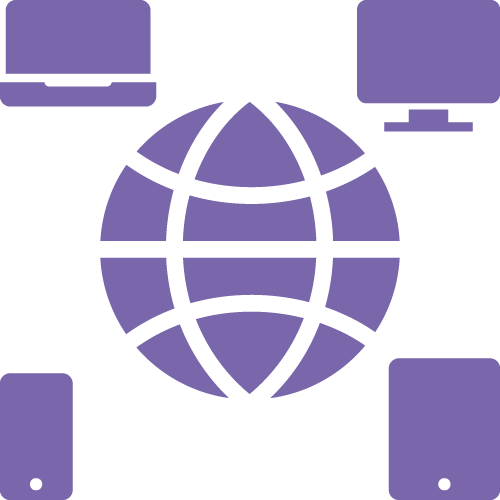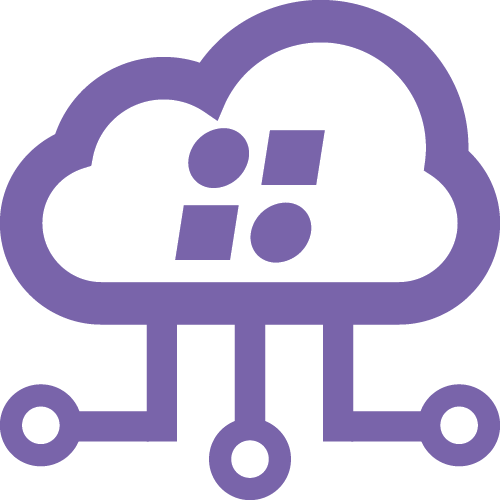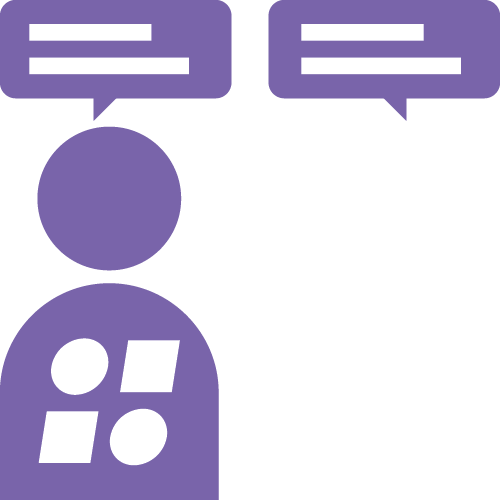ATM, kurz für Asynchronous Transfer Mode, ist eine Netzwerktechnologie, die in den 1990er-Jahren als vielversprechender Standard für Hochgeschwindigkeitskommunikation galt. Sie wurde entwickelt, um Sprache, Video und Daten in einem einheitlichen Netzwerk übertragen zu können – mit garantierter Qualität und niedriger Latenz. Auch wenn ATM heute größtenteils von IP-basierten Technologien abgelöst wurde, gibt es nach wie vor Szenarien, in denen ATM eine Rolle spielt.
ATM basiert auf der Idee, Informationen in kleine, gleichgroße Zellen zu zerlegen. Jede Zelle ist genau 53 Byte groß: 5 Byte Header und 48 Byte Payload. Dadurch lassen sich Datenströme effizient und deterministisch durch das Netzwerk leiten – ein Vorteil gegenüber variabler Paketgröße bei IP.
ATM in der Praxis: Wo wird es eingesetzt?
Aus Erfahrung wissen viele Admins, dass ATM einst in Carrier-Netzen, Backbones und Bankennetzwerken eine zentrale Rolle spielte. Auch heute noch existieren ATM-Teilstrecken in einigen Infrastrukturen, etwa in alten DSLAMs oder als unterliegende Technik bei ISDN/DSL.
Typische Einsatzbereiche:
- Backbone-Strukturen von Telekommunikationsanbietern
- Universitätsnetzwerke und Forschungseinrichtungen
- Bankennetzwerke mit hohen Sicherheitsanforderungen
- Verbindungen zu Frame Relay– oder Leased-Line-Systemen
Man könnte sagen: ATM ist ein „stilles Fundament“, das in bestimmten Altstrukturen weiterhin funktioniert – selbst wenn es aus der modernen Diskussion fast verschwunden ist.
Technischer Aufbau von ATM-Netzen
Ein ATM-Netzwerk besteht aus sogenannten ATM-Switches, die die kleinen Zellen anhand ihrer Headerinformationen weiterleiten. Anders als bei IP-Routing ist der Pfad für eine Verbindung – der sogenannte Virtual Circuit – bereits bei der Verbindungsaufnahme festgelegt.
Es gibt zwei Typen von Circuits:
- PVC (Permanent Virtual Circuit): Statisch konfiguriert, dauerhaft aktiv
- SVC (Switched Virtual Circuit): Dynamisch aufgebaut, wie bei einem Telefonanruf
Die ATM-Switches agieren nicht anhand von IP-Adressen, sondern nutzen sogenannte VPI/VCI-Werte (Virtual Path Identifier / Virtual Channel Identifier), die im Zell-Header codiert sind.
Vorteile von ATM gegenüber klassischen IP-Netzen
Auch wenn ATM heute nicht mehr Mainstream ist, bietet es einige konzeptionelle Vorteile, die es gerade in hochverfügbaren Netzen attraktiv machten:
- Feste Zellen führen zu vorhersagbaren Laufzeiten (geringes Jitter)
- QoS-Unterstützung für verschiedene Serviceklassen (CBR, VBR, ABR, UBR)
- Verbindungsorientierte Kommunikation mit garantierter Bandbreite
- Multiservice-Fähigkeit (Daten, Sprache, Video über denselben Kanal)
Ein häufiger Fehler in der Praxis war es, ATM nur als „schneller“ zu betrachten – dabei liegt der eigentliche Vorteil in der kontrollierbaren Qualität des Datenstroms.
Nachteile und Herausforderungen mit ATM
Wie bei vielen früh gepriesenen Technologien zeigte sich auch bei ATM im Laufe der Zeit, dass nicht alles Gold ist, was versprochen wurde:
- Hoher Overhead durch kleine Zellgröße (53 Byte)
- Komplexe Konfiguration von Switches und Circuits
- Hohe Kosten für Hardware und Betrieb
- Inkompatibilität mit IP-Welt ohne spezielle Gateways
Ein weiterer Kritikpunkt: Die Technologie war für kleinere Netzwerke oft überdimensioniert. Mit dem Aufstieg von Fast Ethernet, Gigabit und MPLS wurde ATM zunehmend verdrängt.
ATM vs. MPLS: Ein technologischer Generationenwechsel
MPLS (Multiprotocol Label Switching) gilt in vielen Fällen als der „ATM-Nachfolger“. Auch MPLS bietet labelbasiertes Switching und QoS – allerdings auf IP-Basis und damit flexibler in heutiger Infrastruktur. Viele Provider migrierten ATM-Backbones auf MPLS, um Kosten zu sparen und gleichzeitig moderne Dienste anbieten zu können.
Trotzdem: ATM-Konzepte haben in MPLS und SD-WAN Einzug gefunden. So ist etwa das Label-Switching-Prinzip bei MPLS stark von ATM inspiriert.
ATM in der Ausbildung und Forschung
Wer Netzwerke studiert oder sich mit Protokollhistorie befasst, trifft früher oder später auf ATM. Es ist ein gutes Beispiel für deterministische, verbindungsorientierte Netzwerke und eignet sich hervorragend zur Diskussion von QoS-Modellen, Switching-Prinzipien oder Lastverteilung.
Tools wie GNS3 oder spezialisierte Emulatoren erlauben den Aufbau einfacher ATM-Testnetzwerke – inklusive Zellanalyse, PVC-Konfiguration und Traffic-Shaping.
Best Practices beim Umgang mit ATM in Altstrukturen
In produktiven Umgebungen, wo ATM noch verwendet wird, gelten einige Grundsätze:
- Monitoring ist Pflicht: ATM-Fehler sind selten offensichtlich
- Dokumentation der VPI/VCI-Zuweisungen ist essenziell
- QoS-Parameter regelmäßig prüfen, besonders bei Echtzeitanwendungen
- Schnittstellen zu IP-Welt absichern (z. B. ATM-to-Ethernet-Gateways)
Und natürlich: Frühzeitig Migrationsstrategien entwickeln. Auch wenn ATM funktioniert, ist es kein langfristiges Zukunftsmodell mehr.
Fazit: ATM als wichtiger Meilenstein der Netzwerktechnik
Wie bereits mehrfach angedeutet: ATM ist heute zwar nicht mehr das Rückgrat moderner Netze, aber es war ein Meilenstein. Die Idee, verschiedene Dienste mit garantierter Qualität über eine einheitliche Infrastruktur zu realisieren, hat weit über die Technik hinaus gewirkt.
Wer ATM versteht, hat ein besseres Verständnis für moderne Netzwerkarchitekturen und die Herausforderungen bei QoS, Lastverteilung und Pfadsteuerung. Auch wenn man ATM nicht mehr selbst konfiguriert, liefert es wertvolle Impulse für Netzwerkdesigns von heute und morgen.
Interesse an ATM-Technologie, modernen Übertragungswegen oder Netzwerklösungen?
Wir helfen Ihnen bei der Planung, Umsetzung und Optimierung komplexer Netzwerkinfrastrukturen – ob ATM, MPLS oder andere Übertragungs-Technologien.
→ Kontaktieren Sie uns – wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Netzwerk!